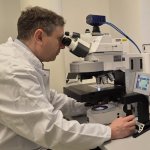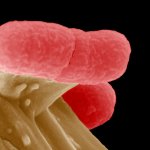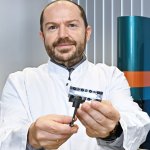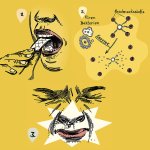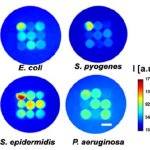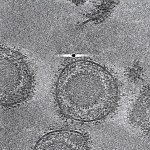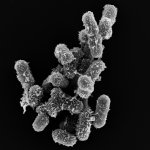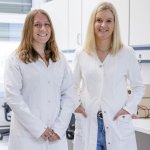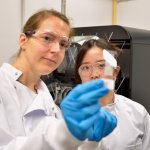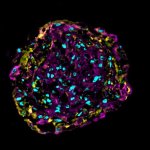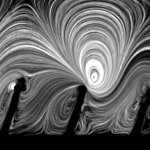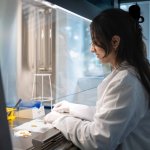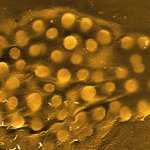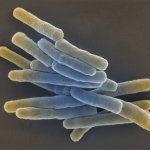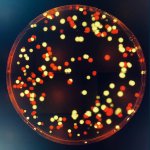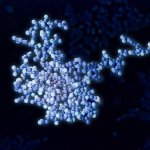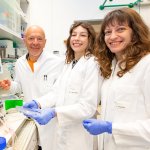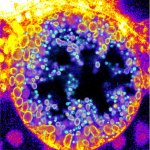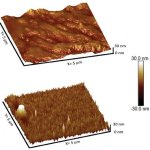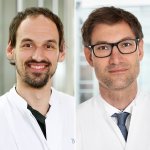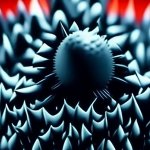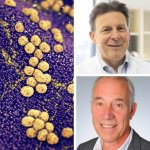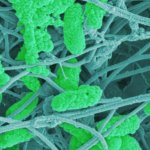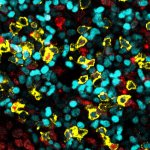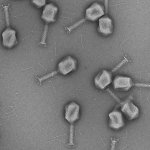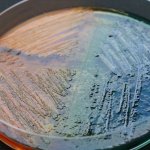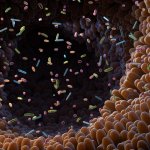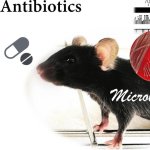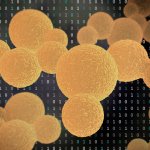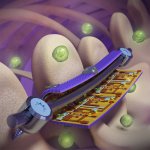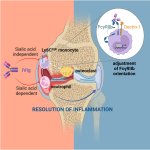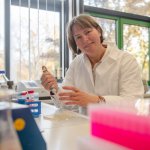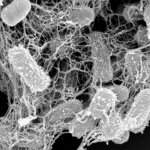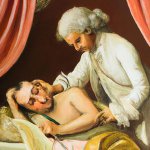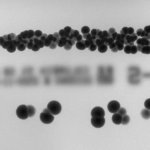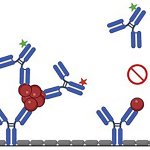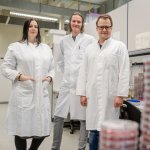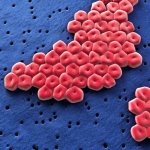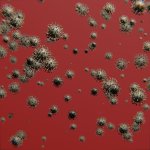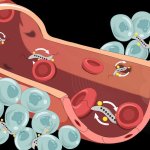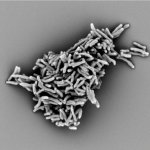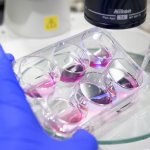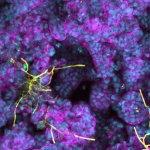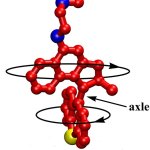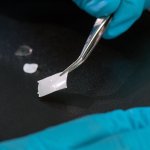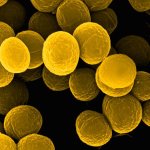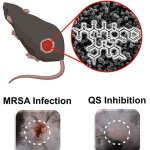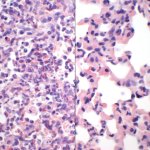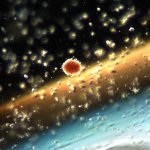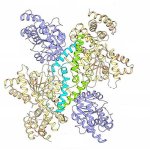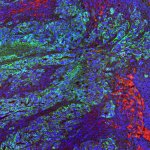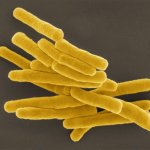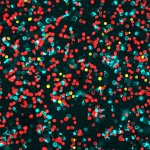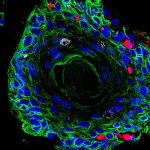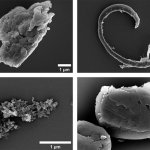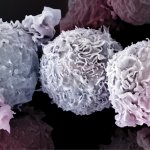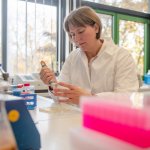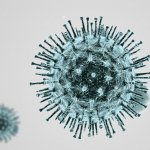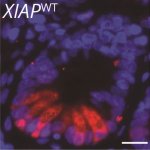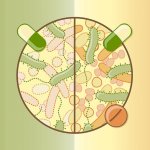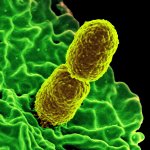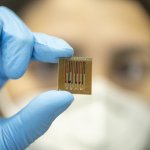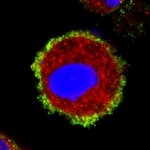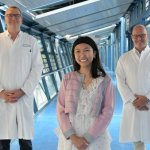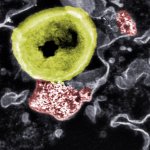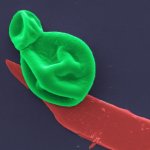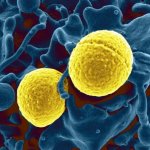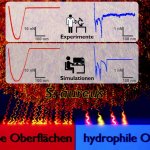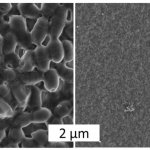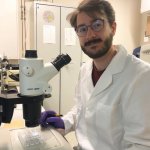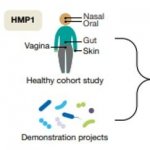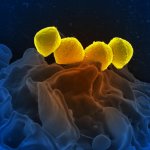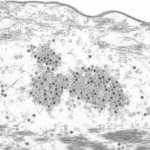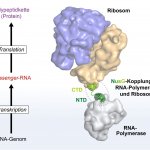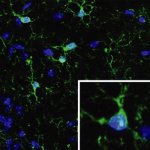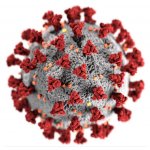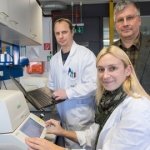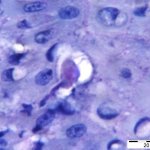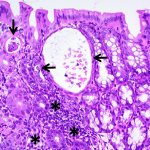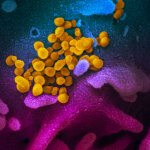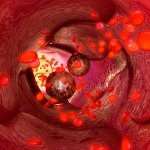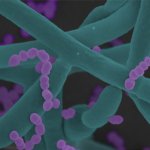
News • Koinfektions-Strategien
Pilze und Bakterien können gefährliche Allianz bilden
Forscher zeigen, dass der Hefepilz Candida albicans und das Bakterium Enterococcus faecalis unter bestimmten Bedingungen eine Allianz bilden – und gemeinsam deutlich schwerere Schäden verursachen.