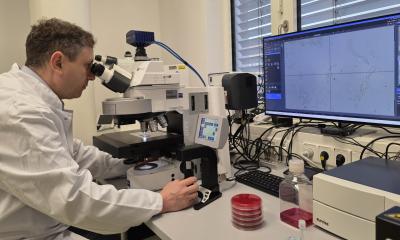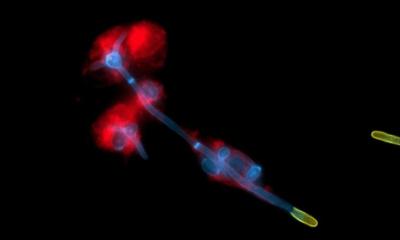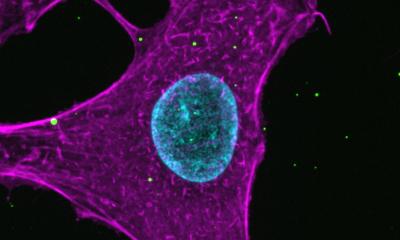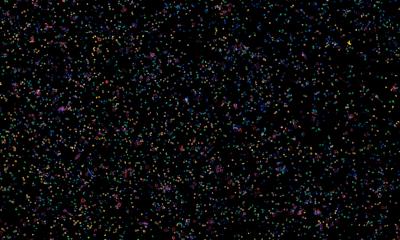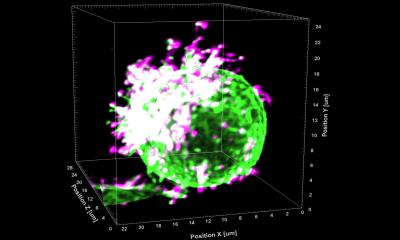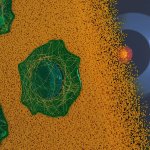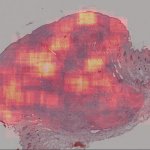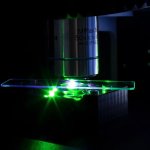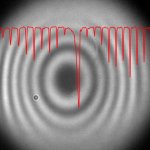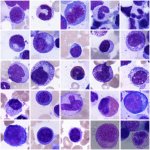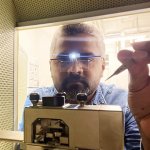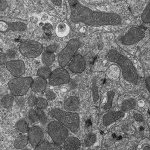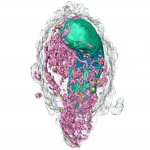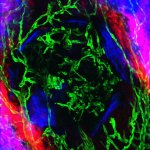
News • Mikroskopiemethode zeigt Unterschiede
Neue Einblicke: Schädel heilen anders
Der Schädel heilt nach Verletzungen anders als andere Knochen. Diese Beobachtung gelang jetzt erstmals einem Forscherteam mithilfe eines hochspezialisierten Lasermikroskops.