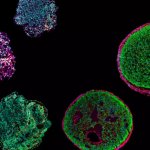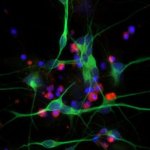News • Elektrostimulation im Netzwerk
Muskeltremor: Mensch-Maschine-Schnittstelle soll Abhilfe schaffen
Wissenschaftler haben eine Technologie-Plattform mit biokompatiblen Elektroden entwickelt, die Menschen mit Muskelzittern künftig helfen soll, den Tremor zu stoppen.