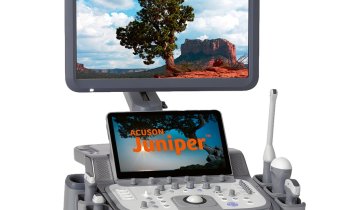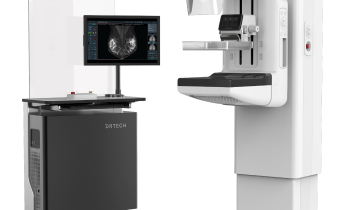Bildquelle: Medizinische Universität Innsbruck; Foto: David Bullock
News • Behandlungsoptionen im Vergleich
TAVI oder Chirurgie: Studie erlaubt fundierte Wahl beim Herzklappenersatz für Frauen
Mehr Frauen als Männer leiden unter schwerer Herzinsuffizienz aufgrund einer Klappenverengung. In Studien waren sie jedoch stets unterrepräsentiert.
Die kürzlich veröffentlichte RHEIA-Studie ist daher in mehrfacher Hinsicht besonders: Sie ist die erste großangelegte prospektiv randomisierte Herzklappen-Studie mit einem gendermedizinischen Fokus weltweit. Anfang April veröffentlichte das European Heart Journal die Ergebnisse der Intervention nach zwölf Monaten Beobachtungszeit. Diese liefern den Behandlern die erste fundierte Grundlage für eine differenzierte Wahl der Methode beim Klappenersatz, wie Nikolaos Bonaros von der Univ.-Klinik für Herzchirurgie an der Medizinischen Universität Innsbruck erläutert.
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine erkrankte Herzklappe zu ersetzen: Herzchirurgen entfernen die defekte Klappe und passen eine neue Klappe aus tierischem Material an, die mit Nähten fixiert wird. Eine Operation am komplett offenen Brustkorb ist dafür meistens nicht mehr nötig. Die Eingriffe können bei 95% der Patienten minimalinvasiv über einen kleinen Schnitt am Brustbein durchgeführt werden. Eine Vollnarkose und der Einsatz der Herz-Lungen-Maschine sind dafür allerdings notwendig. Die andere, neuere Option heißt TAVI. Dabei führen Kardiologen und Herzchirurgen mittels Katheter die neue, mit einem Drahtrahmen stabilisierte Herzklappe ein und schieben diese über die erkrankte Klappe. Die Katheterklappe wird am Kalk der defekten Klappe – die nicht entfernt, sondern nur verdrängt wird – eingehängt und aufgespannt. Dafür ist lediglich eine örtliche Betäubung, jedoch keine Herz-Lungen-Maschine erforderlich.
Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

Artikel • Gendermedizin
„Frauen müssen stärker in Studien und Leitlinien einbezogen werden“
Frauen und Männer sind unterschiedlich. Kaum jemand wird diese Aussage anzweifeln, dennoch spielt das Geschlecht in der Medizin eine untergeordnete Rolle. Weder in der Forschung noch in der Prävention noch in der Therapie wird dieser Unterschied angemessen berücksichtigt. „Das ist nicht länger akzeptabel“, findet Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek.
Welche Option für Frauen besser ist, wusste bisher niemand. Im Rahmen der RHEIA-Studie erhielten nun insgesamt 420 Frauen (Durchschnittsalter 73 Jahre) an 48 Zentren im Rahmen der Studie einen Klappenersatz, die Hälfte wurde chirurgisch, die andere Hälfte mit der Kathetermethode TAVI behandelt. Die Zuordnung erfolgte randomisiert mittels Zufallsgenerator. In Innsbruck wurden 17 Patientinnen behandelt, österreichweit waren es 63. Die letzte Patientin wurde Ende des Jahres 2022 in die Studie eingeschlossen.
Bei einer 70-Jährigen ohne Vorerkrankungen zählt, wie es ihr in den nächsten 15 Jahren geht. Man muss auf Langfristigkeit setzen und wird die klassische chirurgische Methode bevorzugen
Nikolaos Bonaros
Die gesammelten Resultate nach zwölf Monaten Beobachtungszeit zeigen nun, „dass beide Methoden exzellent für Frauen sind“, sagt Bonaros. Sowohl die Operation als auch die Katheter-Intervention können mit einem minimalen Risiko durchgeführt werden (Tod innerhalb von 12 Monaten: 0,9%). Die Wahrscheinlichkeit, während oder kurz nach dem Eingriff einen Schlaganfall durch sich lösenden Kalk zu erleiden, ist mit 3% sehr gering.
Bei der Zahl der Wiederaufnahmen in die Klinik ergaben sich jedoch Unterschiede: Nach einem chirurgischen Eingriff mussten 11,4% der Frauen im ersten Jahr wiederum im Krankenhaus behandelt werden. Demgegenüber schnitt TAVI mit 4,8% Wiederaufnahmen besser ab. „Dieses Ergebnis war erwartbar. Eine Operation ist eine größere Manipulation am Gewebe, der Körper reagiert unmittelbar danach. Mehr Frauen hatten Pleuraergüsse oder Herzrhythmusstörungen, die gut behandelbar sind. Für die Patientinnen bedeuten diese wiederholten Krankenhausbesuche, auch wenn sie nur in den ersten Wochen nach dem Eingriff stattfinden, jedoch eine Einschränkung der Lebensqualität“, erklärt Bonaros.
In der Folge von TAVI ist allerdings mit 8,8% häufiger die Implantation eines Schrittmachers notwendig als nach der Operation (2,9%). Der Grund ist, dass der Impulsgeber des Herz-Reizleitungssystems in unmittelbarer Nähe der Aortenklappe liegt. Dieser gibt die elektrische Aktivität an die Herzkammer weiter. „Bei einem Eingriff mittels Katheter ist das Reizleitungssystem nicht erkennbar und kann daher abgedrückt werden. Wir Chirurgen sehen das System und setzen die Klappe so ein, dass kein Druck entstehen kann.“ Die Funktion der Klappe in der Echokardiografie war für die chirurgischen Klappen besser. „Da TAVI über die alte, verkalkte Klappe gedrückt wird, ist sie nicht genau angepasst. Dadurch entsteht häufiger ein Rückfluss des Blutes. Die Prognose einer undichten Klappe, die nicht richtig schließt, ist schlechter. Dieses Ergebnis war nach der Operation besser“, erläutert der leitende Chirurg.
Diese ersten Ergebnisse des 1-Jahres-Überlebens von Patientinnen können die Behandler künftig bei den individuellen Abwägungen zur Wahl der Methode berücksichtigen. „Bei einer 70-Jährigen ohne Vorerkrankungen zählt, wie es ihr in den nächsten 15 Jahren geht. Man muss auf Langfristigkeit setzen und wird die klassische chirurgische Methode bevorzugen. Für eine Frau, die älter ist, oder bereits Vorerkrankungen wie Schlaganfall, Diabetes, Adipositas hat oder immobil ist, wird TAVI die bessere Methode sein. Wir können die Vor- und Nachteile der Interventionen für Patientinnen jetzt besser abgrenzen“, folgert Bonaros aus den Resultaten.
Die Auswertungen der RHEIA-Studie sind noch nicht abgeschlossen. Aktuell werden bereits die Ergebnisse für das Fünfjahres-Überleben gesammelt. Relevant wird auch der Outcome beim Zehnjahres-Überleben sein.
Die Wahrscheinlichkeit einer Herzinsuffizienz aufgrund einer Klappenerkrankung steigt ab 65 Jahren (2% der Gesamtbevölkerung) stark an. Mit 70 Jahren leiden bereits 3% der Menschen darunter, ab 75 sind es 4%. Die Lebenserwartung von Frauen ist allgemein höher, sie sind daher öfter von Aortenklappenstenosen betroffen als Männer. Mit den Jahren lagert sich Kalk an den Klappen ab, die sich dadurch nicht mehr ganz öffnen können und das Blut nicht mehr richtig durch das Herz schleusen und im Körper verteilen. Atemnot ist das Hauptsymptom – zuerst nur bei Belastung, dann auch in Ruhe. Ein Aortenklappenersatz ist dann lebensnotwendig. Ohne Eingriff stirbt die Hälfte der Patienten im Laufe von zwei Jahren.
Quelle: Medizinische Universität Innsbruck
22.05.2025