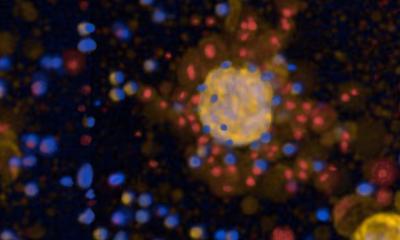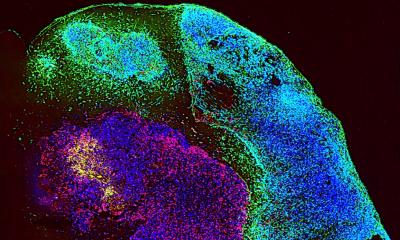Pharmakogenetik: Für Patientengruppen maßgeschneiderte Medikamente
Interview: Michael Krassnitzer
An der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg (Österreich) wurde im Januar ein Zentrum für Pharmakogenetik und Pharmakogenomik eröffnet. EUROPEAN HOSPITAL spricht mit Univ.-Prof. Dr. Markus Paulmichl, dem Leiter der neuen Forschungseinrichtung.

Warum spielen Pharmakogenetik und Pharmakogenomik eine immer bedeutendere Rolle in der medizinischen Forschung?
Das eine Medikament für alle Patienten gibt es nicht. Eine Gruppe von Patienten reagiert auf ein Medikament so wie gewünscht. Bei einer zweiten Gruppe hingegen beobachtet man überhaupt keine Wirkung und bei einer dritten kommt es zu Komplikationen. Der Gedanke liegt nahe, dass das etwas mit dem genetischen Kostüm zu tun hat. Daher wird untersucht, ob die genannten Patientengruppen Mutationen bei jenen Genen aufweisen, die in die Aufnahme, die Verteilung und den Abbau von Medikamenten im Körper involviert sind.
Können Sie hier ein Beispiel nennen?
Das Leberenzym CYP2D6, das für den Abbau von Xenobiotika notwendig ist, baut zirka 20 Prozent der in Europa verwendeten Medikamente ab. Bei sechs bis acht Prozent der kaukasischen Europäer funktioniert dieses Enzym nur ungenügend, bei diesen Menschen sind also Nebenwirkungen zu erwarten. Ungefähr vier Prozent der Europäer haben eine übermäßige Funktion, so dass Medikamente zu schnell abgebaut werden und nicht die therapeutische Konzentration erreichen. Das sind signifikante Zahlen.
Welche konkreten Forschungsprojekte verfolgen Sie am Zentrum für Pharmakogenetik und Pharmakogenomik in Salzburg?
Zu Beginn der pharmakogenetischen Forschung hat man sich auf die metabolisierenden Enzyme konzentriert. Wir hingegen legen den Fokus auf jene Strukturen, die für die Aufnahme und Verteilung von Medikamenten verantwortlich sind. Das ist ein neuer Bereich, dem große Bedeutung beizumessen ist. Einer unserer zentralen Forschungsbereiche ist die Blut-Hirn-Schranke. Im Gehirn gibt es pathologische Veränderungen, die man pharmakologisch kontrollieren möchte. Die Blut-Hirn-Schranke aber sorgt dafür, dass viele Substanzen, die sich im Blut befinden, nicht ins Gehirn gelangen. Ein zweiter Forschungsbereich betrifft das Bronchial-Epithel, weil zum Beispiel in der Asthma-Behandlung Medikamente über Inhalatoren in der Lunge appliziert werden, aber die Zielzellen nicht direkt an der Oberfläche liegen. Beim Überwinden solcher Barrieren spielen Transporter eine zentrale Rolle. Auch auf diese hat das genetische Kostüm natürlich einen Einfluss.
Ist die Pharmakogenetik ein Schritt in Richtung personalisierte Medizin?
Die Entwicklung geht auf jeden Fall in Richtung einer starken Segmentierung des Patientenpools.
Führt eine solche Segmentierung nicht zu höheren Kosten?
Insgesamt könnte für das Gesundheitssystem eine schwarze Null unter dem Strich stehen. Klinische Studien könnten in kleinerem Maßstab durchgeführt werden, weil sie nicht mehr möglichst breit die Wirkung in der gesamten Population abdecken müssen. Daher könnte es bei den Entwicklungskosten eines Medikaments zu großen Einsparungen kommen. Auch mit der Reduktion von Nebenwirkungen könnte man sich viel Geld ersparen. Wenn man die Daten aus den USA hochrechnet, dann geben wir allein in der Region Salzburg 100 Millionen Euro für die Therapie von Arzneimittelnebenwirkungen aus. Das ist eine stolze Summe. Aber das Geld, das man sich dabei erspart, wird man wohl in die Diagnose stecken müssen. Allerdings sollte sich die Diskussion nicht immer auf die Kosten reduzieren. Der Vorteil für den Patienten ist evident: Er bekommt das Medikament mit den wenigsten Nebenwirkungen.
Wo sehen Sie mögliche Hindernisse?
Für den Kliniker wird die Sache komplexer werden. Ein Problem wird sicher die Ausbildung und Weiterbildung der Ärzte sein, die ja bisher ohne Pharmakogenetik ausgekommen sind. Sie müssen davon überzeugt werden müssen, welche Vorteile dieser neue Ansatz für die Patienten mit sich bringt.
20.04.2011