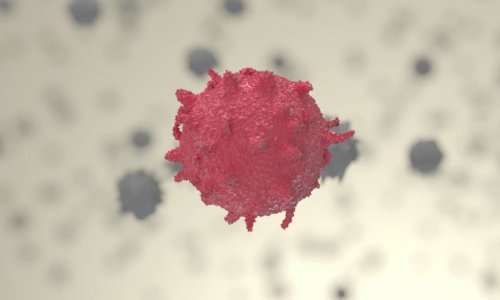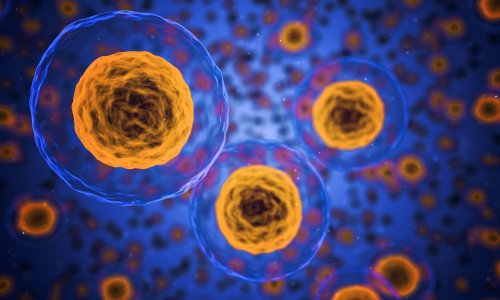News • Paradigmenwechsel in der MS-Therapie
Multiple Sklerose: Heilung durch Stammzelltransplantation?
Verschiedene Therapien sind heute hocheffektiv zur Prophylaxe der Krankheitsschübe bei Multipler Sklerose (MS), jedoch relativieren neuere Studien den Erfolg im Hinblick auf die langfristige Progressionshemmung.
Eine Stammzelltransplantation dagegen ermöglicht einen Neustart des Immunsystems und ist ein auf Heilung ausgerichtetes Therapieprinzip. Bisher galt sie jedoch als sehr risikoreich und wurde nur als „ultima ratio“ eingesetzt. Vor dem Hintergrund neuerer Daten sieht PD Dr. Harald Prüß, Neuroimmunologe an der Charité, auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) das Potenzial für einen breiteren Einsatz.
Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

News • Stammzelltransplantation
Hilft Immun-„Reboot“ bei Multipler Sklerose?
Bei der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose (MS) greifen die Zellen des Immunsystems fälschlicherweise die eigenen Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark an. Um das zu verhindern, kommen verschiedene Therapien zum Einsatz – Antikörper, die gezielt in das Krankheitsgeschehen eingreifen, oder Immuntherapeutika, die das Immunsystem unterdrücken. Eine Art Neustart („Reboot“) des…
Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS) mit ca. 230.000 Betroffenen in Deutschland. Bei der immunologisch vermittelten Erkrankung greifen Zellen des Immunsystems fälschlicherweise die körpereigenen Nervenzellen des Gehirns und des Rückenmarks an, wo es zu Entzündungsherden kommt. MS verläuft meistens schubförmig und führt über die Zeit oftmals zu zunehmender Behinderung. Mit sogenannten verlaufsmodifizierenden Therapien kann die Zeit zwischen den Schüben verlängert und die Schwere eines Schubs abgemildert werden. Wesentliches Therapieziel ist aber immer die Verhinderung der Krankheits- und Behinderungsprogression.

Die enorme Entwicklung der Therapieoptionen bei MS setzt sich immer weiter fort und es sind heute unterschiedlich ansetzende, z. T. hochwirksame krankheitsmodifizierende Therapien verfügbar (Immunsuppressiva bzw. Immunmodulatoren sowie Antikörper und „small molecules“, die gezielt die Entzündungskaskade unterbrechen) – doch nicht alle erweisen sich als effektiv. Eine neue Studie mit dem Tyrosinkinasehemmer Evobrutinib zeigte zwar eine Reduktion von Hirnläsionen im MRT, aber keine statistisch signifikanten Unterschiede gegenüber Placebo in Hinblick auf die jährliche Schubrate und Progression der Behinderung. Ob Evobrutinib das Potenzial zur langfristigen Progressionsreduktion hat, wird erst eine Nachbeobachtungszeit über die bisherigen 24 Wochen hinaus zeigen.
Das langfristige Ziel der Progressionsverhinderung erfüllen selbst die Therapien nicht, die erfolgreich MS-Schübe abwenden. Unter einer verlaufsmodifizierenden Therapie ist die MS-Progression zwar seltener, jedoch kam es in der prospektiven UCSF-MS-EPIC-Studie mit über 400 Patienten bei mehr als der Hälfte innerhalb von zehn Jahren zur signifikanten Zunahme der Behinderung. Anhand der aktuellen Studiendaten des 14-Jahres-Follow-ups der UCSF-MS-EPIC-Kohorte wurde nun untersucht, welche Bedeutung klinische MS-Schübe sowie MS-Aktivitätszeichen in der MRT-Bildgebung für die langfristige Behinderungsprogression haben. Im Ergebnis zeigte sich, dass das Auftreten von Schüben zwar deutlich mit einem vorübergehenden Anstieg des Behinderungsgrades assoziiert war (p = 0,012), nicht jedoch mit der endgültigen bzw. langfristigen Behinderungsprogression (p = 0,551). Bei einem Drittel der Patienten mit schubförmiger MS nahm der Behinderungsgrad trotz erfolgreicher Schubprophylaxe zu – die Studienautoren sprechen daher von einer „stillen“ Progression. „Eine verlaufsmodifizierende Therapie unterdrückt offensichtlich erfolgreich die Schübe, also die „Gipfel“ der krankhaften Immunreaktion, sie kann jedoch die Erkrankung nicht heilen und bei einigen Patienten auch das Fortschreiten nicht verhindern“, so PD Dr. Harald Prüß, Neurologe an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und Neurowissenschaftler am DZNE Berlin.
Die Stammzelltransplantation dagegen ist kurativ ausgerichtet, da sie mit einer Art „Neustart“ des Immunsystems sämtliche gegen sich selbst gerichtete Fehlprogrammierungen löscht. Blutbildende Stammzellen werden dem Patienten entnommen; danach erfolgt eine Chemotherapie, die das Knochenmark und damit auch die falsch programmierten Immunzellen (nahezu vollständig) zerstört. Anschließend erhält der Patient die zuvor entnommenen „gesunden“ Blutstammzellen, die dann ein neues Immunsystem aufbauen. Das Verfahren zeigte sich in früheren Studien als vielversprechend, jedoch auch nebenwirkungs- und risikoreich: In seltenen Fällen kann der Aufbau eines neuen Immunsystems misslingen, die Patienten sind dann schutzlos allen Erregern ausgesetzt. Deshalb wird das Verfahren bislang nur als „ultima ratio“ eingesetzt. Eine randomisierte, multizentrische Studie verglich die Wirksamkeit der Stammzelltransplantation mit den medikamentösen Therapien. Im Ergebnis zeigte sich, dass nach fünf Jahren die Progressionsrate nach dem Eingriff 9,7% betrug, aber 75,3% unter der medikamentösen Therapie; Rückfälle waren in der transplantierten Gruppe seltener, die Lebensqualität höher, der Grad der Behinderung hatte sogar abgenommen. Auch das Nebenwirkungsprofil war in der Studie vertretbar: Die Toxizität erreichte maximal Grad 3, es gab keine lebensbedrohlichen Ereignisse und keine Todesfälle. Limitiert werden die Ergebnisse allerdings dadurch, dass neue hochwirksame Medikament, wie Ocrelizumab, in der Kontrollgruppe noch nicht verfügbar waren.
„Ob die Stammzelltherapie langfristig und bei unterschiedlich betroffenen MS-Patienten die Krankheits- und Behinderungsprogression verhindern kann, muss noch abgewartet werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Studienlage sollte die Stammzelltransplantation allerdings häufiger als bisher im klinischen Alltag bei ausgewählten Betroffenen zum Einsatz kommen, zumal sie in erfahrenen Zentren mittlerweile mit einer relativ geringen Komplikationsrate einhergeht“, so das Fazit von Dr. Prüß.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Neurologie
30.09.2019