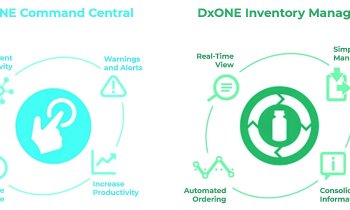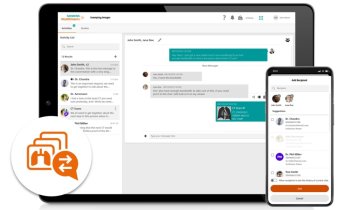© Universität des Saarlandes
News • Studie ermittelt Gründe für Geschlechtergefälle
Wissenschaftlich publizieren: Gleichstellung zwischen Frauen und Männern noch weit entfernt
In der akademischen Medizin sind Frauen und Männer noch lange nicht gleichgestellt. Das gilt insbesondere im wissenschaftlichen Publikationsprozess.
Zu diesem Ergebnis kommt jetzt auch eine Querschnittsstudie für Zeitschriften der Infektionsmedizin: Frauen sind hier deutlich seltener als Letztautoren vertreten als Männer. Und: Der Anteil an Frauen unter den Autoren steigt mit zunehmendem Frauen-Anteil bei den Herausgebern. Die Studie des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität des Saarlandes wurde in der Fachzeitschrift „The Lancet Infectious Diseases“ veröffentlicht.
Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

Artikel • Arbeitsumfeld, Management, Forschung
Frauen in der Medizin
Lange waren Frauen sowohl in medizinischen Führungspositionen als auch in der Forschung unterrepräsentiert - und sind es bis heute. Lesen Sie in unserem Themenkanal, welche Schritte auf dem weiten Weg zur Gleichstellung der Geschlechter im Gesundheitswesen unternommen werden.
Im medizinischen Wissenschaftsbetrieb sind Frauen noch immer unterrepräsentiert, obwohl sie mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Gesundheitswesen ausmachen. Als wichtigster Maßstab für die akademische Produktivität gilt die Publikationsleistung. Im Wissenschaftsbetrieb gilt: Wer viel – und möglichst in einflussreichen Zeitschriften – publiziert, erhält mit höherer Wahrscheinlichkeit Stipendien und Auszeichnungen, wird häufiger zu Vorträgen eingeladen und eher in Führungspositionen befördert. Doch der so genannte Publikationsoutput zeigt deutliche genderspezifische Unterschiede: Frauen veröffentlichen weniger Artikel als Männer und in weniger einflussreichen Zeitschriften, und sie haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, später zitiert zu werden – alles Faktoren, die sich negativ auf ihren beruflichen Aufstieg auswirken.
Um den Ursachen der genderspezifischen Ungleichheiten beim Publikationsoutput auf den Grund zu gehen, wurde in der aktuellen Studie der Zusammenhang zwischen der Herausgeberschaft von Frauen und der Autorenschaft von Frauen näher untersucht. „Wir haben Zeitschriften für Infektionsmedizin unter die Lupe genommen und hier den Anteil weiblicher Erst- und Letztautoren von Publikationen erfasst und diesen mit dem Frauen-Anteil bei den Herausgebern verglichen“, sagt Dr. Cihan Papan, Oberarzt am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Universität des Saarlandes. Die Unterscheidung zwischen Erst- und Letztautorschaft dient dabei der Berücksichtigung von Hierarchieebenen innerhalb des Publikationssystems. „Während Erstautoren meist erst am Anfang ihrer Karriere stehen, sind die Letztautoren in der Regel erfahrene Forscher und die Initiatoren des Forschungsprojekts“, erläutert Katharina Last. Sie ist selber Erstautorin der aktuellen Publikation, die von dem Homburger Team in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien und der Schweiz erarbeitet wurde.
Frauen übernehmen überproportional häufig praktische wissenschaftliche Arbeit in den Forschungsteams. Die Letztautorschaft setzt dagegen mehr Forschungserfahrung und eine höhere hierarchische Position voraus
Katharina Last
In der Studie wurden 40 zufällig ausgewählte wissenschaftliche Zeitschriften aus dem Bereich der Infektionsmedizin analysiert (alle im jährlichen „Journal Citation Reports“ aufgeführt). Alle Zeitschriften hatten mehrere Herausgeber, abrufbar waren zudem die Namen und Vornamen der Erst- und Letztautoren sowie die Impakt-Faktoren. Die Auswahl der Zeitschriften erfolgte so, dass das ganze Größenspektrum ihrer Impakt-Faktoren des Jahres 2020 gleichmäßig vertreten war (Der Impakt-Faktor gibt an, wie oft Artikel einer Zeitschrift zitiert werden und gilt daher als Maß für den Einfluss der Zeitschrift. Die Impakt-Faktoren werden jedes Jahr aus den Daten der beiden Vorjahre neu berechnet). Insgesamt flossen rund 11.000 Artikel in die Untersuchung ein.
Die Analysen ergaben eine annähernde Genderparität bei der Erstautorschaft, aber eine ungleiche Verteilung bei der Letztautorschaft und der Herausgeberschaft. „Unter den Erstautoren der Publikationen waren genauso viele Frauen wie Männer, jedoch waren Frauen bei den Letztautoren eindeutig unterrepräsentiert; hier betrug der Frauen-Anteil nur rund 35 Prozent“, sagt Katharina Last. Ein Grund könnte die unterschiedliche genderspezifische Mitwirkung bei Forschungsprojekten sein: „Frauen übernehmen überproportional häufig praktische wissenschaftliche Arbeit in den Forschungsteams. Die Letztautorschaft setzt dagegen mehr Forschungserfahrung und eine höhere hierarchische Position voraus.“
Eine deutliche genderspezifische Diskrepanz zeigte sich auch bei den Herausgebern: Von insgesamt 577 Herausgebern waren 67 Prozent Männer und knapp 33 Prozent Frauen.
Anschließend wurde der Zusammenhang zwischen dem Anteil von Frauen an allen Erst- und Letztautoren und dem Frauen-Anteil an allen Herausgebern ermittelt. „Unsere Analyse zeigt, dass die Herausgeberschaft von Frauen signifikant mit der Erst- und Letztautorschaft von Frauen verbunden ist. Je höher der Anteil von Herausgeberinnen in Zeitschriften über Infektionskrankheiten war, desto höher war auch der Anteil von Erst- und Letztautorinnen im analysierten Zeitraum“, fasst Dr. Cihan Papan das Ergebnis zusammen. Eine mögliche Ursache für diesen Zusammenhang könne unter anderem die unbewusste und implizite genderspezifische Voreingenommenheit der Herausgeber bei der Beurteilung eines eingereichten Artikels sein, so Papan. Andere Gründe können genderspezifische Unterschiede im rhetorischen Ausdruck beziehungsweise der Ergebnispräsentation oder auch die Auswahl an Forschungsmethoden sein. Sein Resümee der Ergebnisse: Da Frauen bei medizinischen Fachzeitschriften seltener in die Position von Herausgebern kommen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Auswahl von Artikeln zur Publikation eine (unbewusste) Selektion stattfindet und daraus eine (ungewollte) Diskriminierung von Frauen als Autorinnen resultiert.
Quelle: Universität des Saarlandes
01.08.2022