Wie soziale Urteile über Mitmenschen entstehen
Klinische Neurophysiologen entdecken Gehirnregion für die Bewertung von Stimmen
Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich haben herausgefunden, welche Gehirnregion dafür zuständig ist, Stimmen von Mitmenschen sozial zu bewerten.
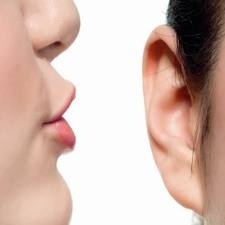
. Bisher hatte sich die Erforschung sozialer Urteile weitestgehend auf die Auswertung von Gesichtern konzentriert, obwohl Stimmen ebenso reich an sozialen Informationen sind. Die Entdeckung könnte zum besseren Verständnis psychischer Krankheiten wie Autismus, Schizophrenie und Depressionen führen, so die Forscher. Ihre Ergebnisse stellen sie am 21. März 2013 auf der Pressekonferenz anlässlich der 57. Wissenschaftlichen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN) vor, die vom 21. bis 23. März in Leipzig stattfindet.
Wie attraktiv oder vertrauenswürdig wir einen Mitmenschen finden, hängt maßgeblich davon ab, wie wir dessen Stimme beurteilen. Das ist seit einigen Jahren erwiesen. Welche Gehirnregion für solche Beurteilungen zuständig ist, haben klinische Neurowissenschaftler der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und des Forschungszentrums Jülich nun mittels hochauflösender bildgebender Methoden entdeckt.
Die Forscher hatten 44 gesunde Erwachsene in einen Magnetresonanztomographen (MRT) gelegt und sie verschiedene Stimmen auf Attraktivität und Vertrauenswürdigkeit hin bewerten lassen. Dabei hielt das MRT alle zwei Sekunden Schnittbilder von den Gehirnen der Probanden fest. „Auf den MRT-Bildern konnten wir eine bestimmte Gehirnregion erkennen, den sogenannten dorsomedialen Präfrontalkortex (dmPFC), die spezifisch beim sozialen Bewerten der Stimmen aktiv wurde“, sagt Professor Dr. med. Simon Eickhoff, Leiter der Arbeitsgruppe „Brain Network Modeling“ am Institute of Neuroscience und Medicine des Forschungszentrums Jülich und Professor am Institut für Klinische Neurowissenschaften der HHU Düsseldorf. Dieses Ergebnis decke sich mit den Erkenntnissen früherer Studien, nach denen der dmPFC aktiv ist, wenn Menschen soziale Urteile fällen – sowohl aufgrund des Betrachtens von Gesichtern als auch durch den Versuch, sich in andere Menschen hineinzuversetzen.
„Damit wurde ein wichtiges Puzzleteil gefunden“, sagt Professor Dr. med. Joseph Claßen, der Tagungspräsident der 57. Wissenschaftlichen Jahrestagung der DGKN. „Es bestätigt, dass der dorsomediale Präfrontalkortex eine Schlüsselfunktion bei der sozialen Urteilsbildung und somit bei der Interaktion und dem menschlichen Zusammenleben hat“, erklärt Lukas Hensel, Doktorand am Forschungszentrum Jülich und Erstautor der Studie.
Die Forscher um Professor Eickhoff sind sich sicher, dass ihre Entdeckung zu einem besseren Verständnis von psychischen Krankheiten führen wird. Weitere Untersuchungen müssten nun zeigen, ob Fehler in der Struktur oder Funktion des dmPFC Erkrankungen wie Autismus, Schizophrenie oder Depressionen auslösen können. Möglich sei auch, dass dieses Areal bei bestimmten Störungen nicht mehr mit anderen Hirnregionen interagiert. „Solche komplexen Psychopathologien sind bisher kaum verstanden“, sagt Eickhoff. Auf der Pressekonferenz zur 57. Wissenschaftlichen Jahrestagung der DGKN, am 21. März von 12.45 bis 13.45 Uhr, wird Eickhoff seine Arbeit ausführlich erläutern. Weitere Informationen zur Pressekonferenz und zur Tagung stehen im Internet unter www.dgkn-kongress.de.
06.03.2013











