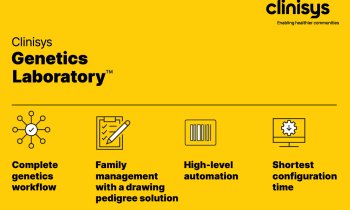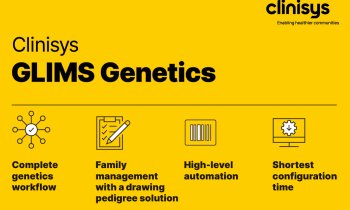Rezeptoren
Wie schmecken wir Wasser? Signalweg entschlüsselt
Wasser schmeckt selten sauer. Aber gerade die Rezeptoren für diese Geschmacksrichtung, signalisieren dem Trinkenden: „Was jetzt über die Zunge strömt, ist Wasser.“ Das haben erstmals Wissenschaftler des Instituts für Anatomie der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen (UDE) zusammen mit Kollegen des California Institute of Technology nachgewiesen.

„Das Richtige zu trinken ist lebenswichtig. Reines, mineralienfreies Wasser schmeckt zwar nach nichts, trotzdem wird es zweifelsfrei beim Trinken erkannt. Uns interessierte, wie so etwas möglich ist“, erläutert Prof. Dr. Gunther Wennemuth, Direktor des Instituts für Anatomie der Medizinischen Fakultät am Universitätsklinikum Essen. Die Forscher sahen sich die unterschiedlichen Geschmacksrezeptoren genauer an und stellten überraschenderweise fest, dass möglicherweise sogar einer der bereits bekannten Rezeptoren für süß, bitter, sauer, salzig oder herzhaft („umami“) für das Schmecken von Wasser verantwortlich sein könnte. Im nächsten Schritt blockierten sie deshalb die Rezeptoren nacheinander und stimulierten die restlichen. So fanden sie heraus, dass die Rezeptoren für „sauer“ auch auf Wasser reagieren.
Um zu belegen, dass diese auch in der Lage sind, Wasser zu erkennen, nutzten die Forscher optogenetische Techniken: Die Erbinformation von Mäusen wurde so verändert, dass deren saure Geschmacksrezeptoren von blauen Lichtimpulsen angeregt wurden. Waren sie durstig, zog es sie zum angebotenen Licht, weil sie es für Trinkwasser hielten. Prof. Gunther Wennemuth: „Aber diese Rezeptoren sind es nicht allein. Wir konnten auch zeigen, dass ein bestimmtes Enzym (Carboanhydrase IV), das wir bisher nur mit der Spermienbewegung in Verbindung brachten, wichtig ist für die Wasserdetektion.“ Wird der Speichel durch das Trinken von Wasser von den sauren Geschmacksrezeptoren weggespült, aktiviert dies das Enzym und vermittelt den Sinneseindruck von Wasser.
Quelle: Universität Duisburg-Essen
12.06.2017