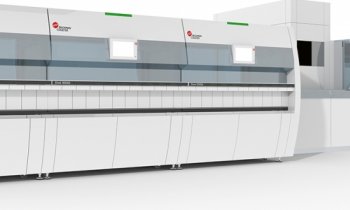Gut organisiert gegen den EHEC-Erreger
Endemie-Management im Krankenhausvon Meike Lerner
Eine besonders aggressive und neue Form des Enterohämorrhagischen Escherichia coli (EHEC) Keims stellte Ende Mai norddeutsche Krankenhäuser vor eine große Herausforderung. In Hamburg, dem Zentrum der Endemie, erkrankten über 1000 Menschen nach einer Infektion mit dem Ehec-Erreger.


Rund 180 von ihnen wurden schwerkrank. Ihr Krankheitsbild war in vielen Konsequenzen unbekannt. 150 dieser komplizierten Krankheitsverläufe wurden im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) behandelt. Es war eine Herausforderung für die Mediziner – und für das Management. So musste innerhalb von Stunden mehrere Isoliereinheiten mit hochspezialisiertem Personal aufgebaut werden, die Anzahl der Dialysegeräte wurde innerhalb weniger Stunden vervielfacht und adhoc täglich durchschnittlich 400 Plasmakonzentrate bereit gestellt. Im Gespräch mit EUROPEAN HOSPITAL (EH) berichtete Prof. Dr. Jörg F. Debatin (JFD), Ärztlicher Leiter und Vorstandsvorsitzender des UKE, wie das Universitätsklinikum Hamburg diese Mammutaufgabe durch die etablierte interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine ebenso schnelle wie effiziente Strukturierung und unbürokratische Hilfe von Außen bewältigte.
EH: Welche Herausforderungen stellte EHEC an das Krankenhausmanagement in Bezug auf die Arbeitsabläufe, die Logistik, das Personal usw.?
JFD: Die Bewältigung einer solchen Aufgabe setzt ein enges, interdisziplinäres Vorgehen voraus. Wir haben diesen Ansatz im UKE bereits etabliert, weswegen wir extrem schnell auf den EHEC-Ausbruch reagieren konnten. Wir beriefen einen Krisenstab ein, der etwa 20 Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen umfasste: Zum Stab gehörten die Kliniker - in erster Linie Nephrologen und Gastroenterologen, später dann auch die Neurologen - Pflegemanagement und Mikrobiologie sowie Vertreter der Logistik , der Hygiene, der Medizintechnik und der Blutbank. Eine Schlüsselposition nahm außerdem die interdisziplinäre Intensivmedizin und die interdisziplinäre Notfallmedizin ein.
Was uns einen wirklichen Vorteil verschafft hat, war auch unser neues und modular aufgebautes Krankenhaus, das uns eine große Flexibilität ermöglichte. Auch die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich flexibel sowohl fach- als auch berufsübergreifend zu engagieren, war beeindruckend. Denn es ist das eine, von Seiten des Managements Personalressourcen von über 8.500 Mitarbeitern umzusteuern. Viel wichtiger ist, dass alle am selben Strang ziehen. Das hat unglaublich gut funktioniert. So war es selbstverständlich, dass die Kardiologen die Hintergrunddienste der Inneren Medizin übernommen haben, weil die Internisten mit der Akutversorgung ausgelastet waren.
Ebenfalls von Vorteil war, dass alle unsere intensivmedizinischen Betten unter einer Leitung stehen. Dadurch konnten wir schnell Prioritäten setzen und zwei HUS-Abteilungen mit je 12 Betten einrichten – ohne dass wir die Bedürfnisse der anderen rund 1.300 schwerkranken Patienten außer Acht lassen mussten.
Was uns bei der Bewältigung der Krise darüber hinaus unterstützte, war der Einsatz der elektronischen Patientenakte. Die an allen Orten im UKE elektronisch verfügbaren Daten haben den interdisziplinären Ansatz vereinfacht, das Bettenmanagement deutlich erleichtert. Wir wussten immer, wo wir stehen, um stets auch eine eiserne Reserve verfügbar zu haben. So hatten wir die Situation auch in den turbulentesten Stunden im Griff. Außerdem half die elektronische Patientenakte auch bei der unmittelbar verfügbaren Dokumentation . Denn die Gabe des Antikörpers Eculizumab musste sehr engmaschig und zeitnah verfügbar dokumentiert werden. In der Hochzeit haben sich zwei Pflegekräfte ausschließlich dieser Aufgabe gewidmet – ohne elektronische Patientenakte wäre das dramatisch schwieriger gewesen.
EH: Wann sind Sie – trotz dieser guten Voraussetzungen – an die Kapazitätsgrenzen gestoßen?
JFD: Zu Beginn haben wir zwei Faktoren als kritisch erachtet: Die Kinderdialyse und die Erwachsenen- Plasmapherese. Die Kinderdialyse haben wir sehr schnell in den Griff bekommen, die Plasmapherese stellte eine größere Herausforderung dar: Bis zu 60 Patienten täglich brauchten eine Plasmapherese . Dafür mussten wir unsere Kapazitäten zeitnah um den Faktor 10 erhöhen. Das haben wir zum einen durch das Pooling von Mitarbeitern aus anderen Bereichen des UKE geschafft, die ebenfalls mit Plasmapherese vertraut sind: Kardiotechniker, Herzchirurgen, Anästhesie-Pflegepersonal oder auch Personal aus der Blutbank. Zudem haben wir sehr schnell und unbürokratisch Hilfe von außen bekommen, wie zum Beispiel vom Kuratorium für Heimdialyse, niedergelassenen Praxen und natürlich auch anderen Krankenhäusern.
In dieser hochsensiblen ersten Phase haben wir 10 Prozent der Patienten, die weniger schwer an HUS erkrankt waren, in Kliniken nach Hannover und Berlin verlegt.
Mit dem Einsatz von Eculizumab am Ende der ersten Epidemiewoche wurde die Notwendigkeit zur Plasmapherese dann geringer, so dass einige Kapazitäten frei wurden.
EH: EHEC ist ja ein deutschlandweites Problem, wie funktionierte die nationale Koordinierung und Kommunikation?
JFD: Hier muss man meiner Ansicht nach der deutschen Medizin eine große Schleife umbinden. Denn der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie ist es gelungen, innerhalb von nur 12 Stunden ein bundesweites Review-Protokoll zum Einsatz von Eculizumab abzustimmen. So konnte jeder Patient sicher sein, in jedem Krankenhaus nach den gleichen Standards, die nach bestem Wissen und Gewissen zu dem Zeitpunkt erstellt wurden, behandelt zu werden. Ebenfalls hervorzuheben ist die Kooperationsbereitschaft der Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen, die auf allen Ebenen bis hin zur Personalabbestellung absolut vorbildlich war. Noch nach einigen Wochen arbeitete bei uns Personal des Uniklinikums Heidelberg, des Bundeswehrkrankenhauses und des Kuratoriums für Heimdialyse. Übrigens hat auch die Industrie blitzschnell reagiert und innerhalb von Stunden zusätzliche Dialysegeräte zur Verfügung gestellt.
EH: Als Universitätsklinik waren und sind Sie auch in die EHEC-Forschungen eingebunden. Was war hier die primäre Aufgabe und wie gestaltete sich die Abstimmung mit anderen Unikliniken?
JFD: Aus der wissenschaftlichen Perspektive war es wichtig, sehr schnell strukturierte Wege zur Erfassung und zur Dokumentation zu finden. Insbesondere die Datenakquisition, die Festlegung der Fragebögen sowie die Datenarchivierung standen im Mittelpunkt. Das betrifft auch das Follow-up, mit dem unsere Epidemiologen und Statistiker im Clinical Trial Center betraut sind. Was die Abstimmung mit den anderen universitären Einrichtungen angeht, so genießt der Austausch von Erkenntnissen natürlich oberste Priorität. Alle beteiligten Wissenschaftler im UKE haben den Ansporn, die Daten umfassend und schnell auszuwerten, sodass erste wissenschaftliche Erkenntnisse der UKE-Mediziner über diese Endemie sicherlich bald vorliegen werden.
EH: Vielen Dank für das Gespräch.
16.06.2011