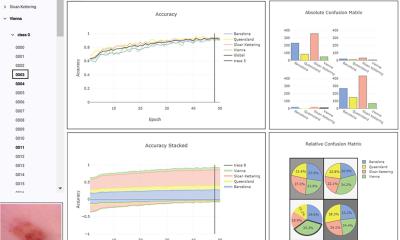Bildquelle: RPTU/Maack, Gillmann
News • "Guardian"-System
Neue Technik zur Analyse und Visualisierung medizinischer Bilddaten
In der Medizin fallen viele Daten an, etwa bei der Computertomographie. Auf dem Weg zur personalisierten Medizin sind sie wichtig.
Verfahren der Künstlichen Intelligenz, wie zum Beispiel das maschinelle Lernen, lernen mit ihnen dazu und helfen, Diagnosen und Therapien künftig individuell zu zuschneiden. Solche Techniken sind aber noch mit Unsicherheiten behaftet. Ein Forscherteam aus Kaiserslautern und Leipzig arbeitet an einem System, das medizinische Daten automatisch analysiert und visualisiert, auch deren Unsicherheiten. Auf der Medizintechnikmesse Medica in Düsseldorf stellt es seine Technik von 13. bis 16. November am Forschungsstand Rheinland-Pfalz (Stand E80, Halle 3) vor.
Beim Schlaganfall ist Eile geboten. Mithilfe von Aufnahmen aus dem Computertomographen (CT) können Ärzte schnell feststellen, an welcher Stelle im Gehirn es zu einem Blutgerinnsel gekommen ist und welche Behandlung sinnvoll ist. Solche bildgebenden Verfahren spielen in der Medizin eine wichtige Rolle. Sie kommen auch bei anderen Bereichen, beispielsweise vor Operationen, zum Einsatz. So helfen Bilder von Magnetresonanztomographien (MRT) Chirurgen etwa vor einer Operation, einen Eingriff zu planen.
Gemein ist all diesen Techniken, dass jede Menge Daten anfallen. „Sie automatisch zu analysieren und zu visualisieren, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur personalisierten Medizin“, sagt Dr. Christina Gillmann, Informatikerin an der Universität Leipzig. „Dieser Bereich hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen.“ Möglich machen das KI-Verfahren wie das maschinelle Lernen und neuronale Netzwerke. Sie lernen anhand von Daten dazu, mit denen sie trainiert beziehungsweise „gefüttert“ werden. Zum Beispiel aus CT-Bilddaten, die ein Arzt zuvor bearbeitet hat. So fließen technische Informationen, aber auch medizinische Erfahrung ein. Dabei gilt: Je mehr Daten diese Verfahren auswerten können, desto besser werden die Ergebnisse.
Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

News • Themenkanal
Medizinisches Datenmanagement
Elektronische Patientenakte, diagnostische Werte, Studienkohorten: Datenmanagement ist zu einem zentralen Bestandteil im Gesundheitswesen geworden – von Diagnostik und Therapie bis zur Forschung.
Solche Technologien könnten in ein paar Jahren im Klinikalltag zum Einsatz kommen, um etwa personalisierte Diagnosen und Therapien zu ermöglichen. Allerdings stecken sie noch in den Kinderschuhen. „Jeder medizinische Fall muss einzeln trainiert werden. Die Daten müssen vorab einzeln aufbereitet werden, was sehr aufwändig ist“, nennt Robin Maack aus der Arbeitsgruppe „Computer Graphics and Human Computer Interaction“ an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) in Kaiserslautern als Problem. Bei jedem medizinischen Fall müssen Ärzte dazu beispielsweise die Daten einzeln „labeln“. „Das bedeutet etwa, wenn ein solches System trainieren soll, einen Tumor automatisch zu erkennen, müssen bei hunderten Bildern mit bekannten Tumoren diese per Hand eingezeichnet werden, damit das neurale Netzwerk eine Grundlage hat, mit der es lernen kann“, erklärt Gillmann.
Maack fährt fort: „Hinzu kommt, dass es keine einheitlichen Schnittstellen gibt, mit denen trainierte Netzwerke behandelt, geladen und genutzt werden können. Aber auch bei Unsicherheiten in den Datenlagen; sei es bei Trainingsdatensätzen oder bei genutzten Modellen; dafür gibt es keine standardisierten Vorgaben, wie Mediziner damit umgehen sollen.“
Solche Unsicherheiten treten zum Beispiel bei Läsionen auf. Dabei handelt es sich um bestimmte Bereiche im Gehirn, die bei einem Schlaganfall durch den Verschluss von Gefäßen im Gehirn nicht mehr ausreichend oder gar nicht mit Sauerstoff versorgt werden. Sie sind nicht mehr leistungsfähig. Der Kern der Läsion ist oft gut zu erkennen, allerdings gibt es am Rand meist keine klare Abgrenzung und Regionen, bei denen sich selbst Ärzte nicht einig sind, ob sie nun als Läsion zu klassifizieren sind oder nicht. Letztendlich braucht es hier die medizinische Erfahrung, wie damit umzugehen ist.
[Die Auswertung und Visiualisierung der Daten] geschieht automatisch, ohne dass IT-Kenntnisse notwendig sind. Außerdem zeigt unsere Methode die Unsicherheiten an
Robin Maack
Hier setzt die Arbeit von Gillmann und Maack an. Das Team um die beiden entwickelt derzeit ein einheitliches System, um medizinische Bilddaten zu verarbeiten, auszuwerten und deren Unsicherheiten zu visualisieren. Es trägt den Namen GUARDIAN, zu Deutsch „Hüter“. Ihre Technik gestalten die Forscher so, dass sie einfach in der Handhabung ist. „Hier können Kliniken beispielsweise ihre trainierten neuralen Netze laden und diese mit zur Verfügung gestellten aufbereiteten Daten kombinieren, etwa bei Aufnahmen zu einem Schlaganfall.“
Das System wertet die Daten aus und visualisiert die Ergebnisse. „Das geschieht automatisch, ohne dass IT-Kenntnisse notwendig sind“, sagt Maack weiter. „Außerdem zeigt unsere Methode die Unsicherheiten an.“ Das heißt, die Ärzte können sich diese noch einmal anschauen und bei Bedarf gemeinsam eine Entscheidung treffen, was im Einzelfall zum Beispiel die beste Behandlung ist.
Auf der Messe stellen die beiden Informatiker ihre Technik vor. Das System steht als Open-Source-Anwendung frei zur Verfügung.
Die Arbeitsgruppe „Visualization and Human Computer Interaction“ von Professor Dr. Christoph Garth an der RPTU in Kaiserslautern forscht schon lange daran, Daten aus Bildgebungsverfahren für die Medizin derart aufzubereiten, dass sie im klinischen Alltag einfach und zuverlässig nutzbar sind. Der Auftritt der Forscher der RPTU Kaiserslautern-Landau bei der Medica wird von Klaus Dosch vom Referat für Transfer, Innovation und Nachhaltigkeit organisiert. Er ist Ansprechpartner für Unternehmen und vermittelt unter anderem Kontakte zur Wissenschaft.
Quelle: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau
04.11.2023