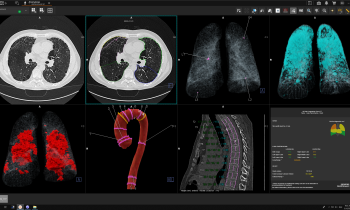Interview • Digitale Potenziale
Seltene Erkrankungen: KI-Kompass für den Diagnostik-Dschungel
Obwohl der Name etwas anderes suggeriert, sind viele Menschen von seltenen Erkrankungen betroffen. Auf der Suche nach der Diagnose vergehen häufig Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Auf dem 1. DACH-Kongress für Seltene Erkrankungen in Innsbruck sprach Prof. Dr. Lorenz Grigull vom Zentrum für seltene Erkrankungen des Universitätsklinikum Bonn darüber, wie künstliche Intelligenz (KI) Patienten diese Odyssee ersparen könnte.
Interview: Wolfgang Behrends
© quickshooting – stock.adobe.com
HiE: Worin sehen Sie die besonderen Herausforderungen in der Diagnostik bei seltenen Erkrankungen?

© Alessandro Winkler / UK Bonn
Prof. Grigull: „Die medizinische Diagnostik ist nicht nur bei seltenen Erkrankungen schwierig. Jeder Mensch ist anders und bei unterschiedlichen Menschen kann die gleiche Erkrankung vielleicht ganz anders aussehen. Es gibt erwiesenermaßen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, ebenso zwischen den Ethnien. Auf der anderen Seite ist das menschliche Wissen und damit auch das ärztliche Wissen begrenzt, und selbstverständlich auch die Zeit, die im Behandlungsprozess für die Diagnosefindung zur Verfügung steht. Und damit sind Schwierigkeiten leider im Grunde vorprogrammiert.
In Europa sprechen wir von einer seltenen Erkrankung, wenn weniger als 5 von 10.000 Menschen betroffen sind. Diese Fälle sind eine besondere diagnostische Herausforderung, denn es gibt schätzungsweise 7000 seltene Erkrankungen mit unterschiedlichen Ausprägungen – die hat natürlich kein Mensch alle im Kopf.“
Wie kann KI in diesen Fällen helfen?
„Ich glaube, dass die Stärke von Verfahren unter Einsatz von KI in Mustererkennung besteht und dass wir damit Ärzte entlasten können. Beispielsweise könnte der Computer, also das Praxissystem, einen Warnhinweis geben, wenn in der digitalen Akte eines Patienten bestimmte Symptome oder verdächtige Konstellationen auftauchen. Und in dem Augenblick, wo diese Symptome und Diagnosen aggregiert werden und ein Algorithmus darauf trainiert ist, Zusammenhänge herzustellen, könnte eine KI daraus eine Verdachtsdiagnose einer übergeordneten seltenen Erkrankung herstellen.1 Das geschieht bislang weitgehend in ‚Handarbeit‘ – auch bei uns am Zentrum für seltene Erkrankungen: Die Patienten schicken uns ihre Unterlagen, und wir versuchen, die verschiedenen Leitsymptome zu objektivieren, zu verschlagworten und dann mittels Recherchetools, auch mittels KI, Hinweise auf seltene Erkrankungen zu finden. Aber all das ließe sich eigentlich auch schon mit heute verfügbarer Technologie in Hausarztpraxissystemen implementieren.“
Sie sprachen die elektronische Patientenakte an. Welche Bedeutung hat die Digitalisierung für diesen Ansatz?
„Die ePA ist ein zentraler Baustein, aber wir haben in Sachen Digitalisierung noch einen weiten Weg vor uns. Die Realität sieht oft so aus, dass wir uns durch Ausdrücke von Laborepikrisen arbeiten müssen, oder durch Fotokopien von Arztberichten und Karteikarten. Leider liegen Gesundheitsinformationen in Deutschland für Patienten meist nur in analoger Form vor. Das ist aktuell die Art der Datenaufbewahrung im Gesundheitswesen.
Wir verfügen über Möglichkeiten, Krankheiten besser zu erkennen – und deshalb haben wir aus meiner Sicht als Gesellschaft auch die Verantwortung, diese Möglichkeiten verantwortungsvoll auszuloten, damit alle Menschen bei uns möglichst gesund leben können
Lorenz Grigull
In anderen Ländern – Kanada, England, USA, zum Teil auch Frankreich, Liechtenstein und natürlich Skandinavien – sind die elektronischen Gesundheitsunterlagen bereits sehr viel etablierter und verbreiteter. Da sind wir in Deutschland aus meiner Sicht ein Schlusslicht, was die Digitalisierung anbelangt, zum Nachteil aller Patienten, besonders auch der Menschen ohne Diagnose oder mit nicht diagnostizierter seltener Erkrankung.
Es ist aus meiner Sicht zutiefst ungerecht, Menschen zu benachteiligen, nur weil ihre Krankheit seltener ist. Wir verfügen über Möglichkeiten, Krankheiten besser zu erkennen – und deshalb haben wir aus meiner Sicht als Gesellschaft auch die Verantwortung, diese Möglichkeiten verantwortungsvoll auszuloten, damit alle Menschen bei uns möglichst gesund leben können.“
Demnach könnte KI dazu beitragen, die Chancen vielleicht ein bisschen gerechter zu verteilen.
„Nicht zwingend, aber möglicherweise. Allerdings ist eine KI immer nur so gut wie ihre Trainingsdaten. Bezogen auf seltene Erkrankungen befürchten daher viele Experten, dass die Datenmenge nicht ausreicht, um den Diagnoseprozess zu unterstützen. Davon bin ich allerdings nicht überzeugt – es kommt vielmehr darauf an, dass die Daten besser verfügbar sind, gut aufbereitet sind und idealerweise umfassend annotiert werden.
Der erste Schritt dafür wäre, entsprechende Register in Deutschland zu etablieren, damit wir überhaupt Daten haben, mit denen wir arbeiten können. Was die Annotierung angeht, tut sich erfreulicherweise viel, zum Beispiel im Rahmen der Medizininformatik-Initiative, an der praktisch alle Uniklinika beteiligt sind. Trotzdem betrifft das bislang nur einen kleinen Anteil der Gesundheitsdaten – der ambulante Bereich fehlt hier etwa völlig. Außerdem reden wir bislang viel zu wenig über länderübergreifende Initiativen. Das wären wichtige Entwicklungen, um das Potenzial, das in diesen Daten steckt, zu nutzen.“
Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren

Artikel • Themenkanal
Digitalisierung im Gesundheitswesen
Von der Telemedizin bis zum Smart Hospital: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens schreitet voran - und bringt aufregende Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen mit sich.
Welche Entwicklungen wünschen Sie sich im Umgang mit seltenen Erkrankungen und KI?
„Wir schauen momentan aus meiner Sicht viel zu stark durch die ärztliche oder fachliche Brille. Ich würde mir wünschen, dass wir die Sichtweise der Patienten und der Angehörigen viel stärker einbeziehen. Die Diagnose ist nur ein Aspekt – am Ende ist das Wohlbefinden, die Lebensqualität entscheidend. Außerdem würde ich mir eine Möglichkeit wünschen, gezielt Daten zu spenden – niedrigschwellig, einfach und transparent.
Denn wir sollten nicht vergessen: Bei seltenen Erkrankungen sprechen wir von fünf Jahren vom ersten Symptom bis zur Diagnose – wenn es gut geht. Es gibt unzählige Geschichten, die wir hier auch regelmäßig hören, von Menschen, die 30, 40, oder sogar 50 Jahre suchen mussten, bis sie wussten, was ihnen fehlt. Das darf nicht normal sein, das darf nie toleriert werden. Wir haben Rechner, die Algorithmen nutzen können. Wir haben entsprechende Modelle, die Muster gut erkennen. Mit diesen Hilfsmitteln sollten wir wirklich jeden Tag versuchen, Wege für Menschen ohne Diagnose mit seltener Erkrankung zu finden. Das ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt dessen, was wir hier am Zentrum für seltene Erkrankungen im Uniklinikum Bonn versuchen.“
Literatur:
Profil:
Prof. Dr. Lorenz Grigull, MBA, MME, ist Ärztlicher Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Zuvor war er an der Medizinischen Hochschule Hannover als Oberarzt in der Kinderonkologie tätig. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Diagnosestellung seltener Erkrankungen.

Linktipp: unrare.me – Social-Media-App für Menschen mit seltenen und chronischen Erkrankungen oder Behinderungen (mit und ohne Diagnose), für ihre Angehörigen und für Experten
12.05.2025