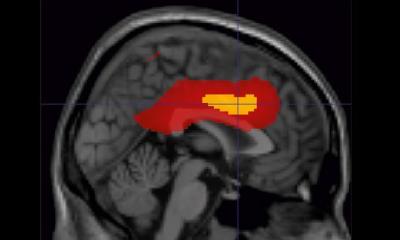News • genomLC-Studie
Long Covid: Genomdaten für bessere Diagnose und Therapie
Die Versorgung von Betroffenen mit Long- und Post-Covid weist trotz der vielen Fortschritte in den letzten Jahren weiterhin große Lücken auf.

Bildquelle: Universitätsklinikum Bonn
So existieren bis heute keine Tests, da bisher keine Biomarker für Langzeitfolgen einer Corona-Infektion bekannt sind. Bonner Forschende des Instituts für Humangenetik möchten nun dazu beitragen, die Diagnose von Long- und Post-Covid zu beschleunigen und mögliche Biomarker ausfindig zu machen, die eventuell auch Subgruppen der Erkrankungen unterscheiden könnten. Dafür werden im Rahmen einer Studie anhand von Blutproben die genomischen Daten von Betroffenen analysiert. Das Projekt wird vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit 1,34 Millionen Euro gefördert.
Nachdem die Covid-19-Pandemie abgeklungen ist, rückte diese für einen Großteil der Menschen in den Hintergrund. Eine nicht geringe Zahl an Infizierten leidet jedoch bis heute an den Spät- und Langzeitfolgen des Coronavirus SARS-CoV-2, sodass Medizin und Wissenschaft weiterhin daran arbeiten, Betroffene durch ihre Forschungsbemühungen zu unterstützen und ihre Versorgung zu verbessern.
Unter den Begriffen Long- bzw. Post-Covid werden verschiedene Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion zusammengefasst. Von Long-Covid wird gesprochen, wenn nach einer Corona-Infektion Symptome länger als vier Wochen anhalten oder neu auftreten. Von Post-Covid spricht man bei Erwachsenen mit Symptomen, die länger als zwölf Wochen nach einer Corona-Infektion andauern oder neu auftreten, und wenn es zu einer Verschlechterung von vorbestehenden Grunderkrankungen kommt. Eine besondere Herausforderung ist, dass die Beschwerden dieser beiden Erkrankungsbilder sehr vielfältig und in ihrer Ausprägung und Dauer oft sehr unterschiedlich sind, über die Zeit variieren und häufig nur schwer von anderen Krankheitsbildern abzugrenzen sind. Auch die Ursachen für die Entstehung der beiden Erkrankungsformen sind bisher noch nicht ausreichend erforscht. Vergleichbare Symptomkomplexe, wie zum Beispiel die Myalgische Enzephalomyelitis und das Chronische Fatigue Syndrom (ME/CFS), sind aber bereits als Folge anderer Infektionskrankheiten beschrieben worden.
Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren
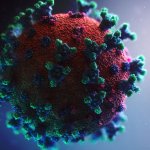
Artikel • Themenkanal zu Covid-19
Coronavirus-Update
Noch Jahre nach dem ersten Ausbruch und Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 ist der Einfluss auf das tägliche Leben zu spüren. Insbesondere das Krankheitsbild Post-Covid ist noch in weiten Teilen ungeklärt. Lesen Sie hier aktuelle Entwicklungen aus Forschung und Politik sowie die Hintergründe zu Covid-19.
„Auch wenn die Gründe für die Entstehung von Long-Covid- und Post-Covid nur unzureichend bekannt sind, gibt es bereits viele Hinweise darauf, dass genetische Variabilität für ein erhöhtes Risiko verantwortlich sein könnte, nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 Langzeitfolgen zu entwickeln. Ebenso vermuten wir, dass die klinisch beobachteten, individuellen Unterschiede bei Long- und Post-Covid auf Varianten in der genetischen Anlage der Betroffenen zurückzuführen sind“, sagt Prof. Dr. Kerstin Ludwig vom Institut für Humangenetik des UKB, die auch Mitglied des Exzellenzclusters ImmunoSensation2 und der Transdisziplinaren Forschungsbereiche (TRA) „Life and Health“ und „Modelling“ der Universität Bonn ist.
Gelingt es uns monogene Long-Covid-Formen bei den Betroffenen zu identifizieren, können eventuell maßgeschneiderte Behandlungen entwickelt werden, die individuell auf die genetischen Besonderheiten der Patienten angepasst sind
Kerstin Ludwig
Die Professorin für Immun- und Infektionsgenetik führt weiter aus: „Gelingt es uns, Long- und Post-Covid-Patientengruppen und ihre Symptome und Beschwerden anhand ihrer genetischen Informationen in Subgruppen einzuteilen, könnte die Berücksichtigung genetischer Informationen bei der Diagnostik ein vielversprechender Ansatz für eine verbesserte Gesundheitsversorgung der Betroffenen und ihre individualisierte Behandlung sein. Aus diesem Grund starten wir die genomLC-Studie“.
Im Rahmen der Studie genomLC soll der Nutzen der Genomsequenzierung in der Long-Covid-Diagnostik beurteilt werden. Ziel ist es zu analysieren, ob Informationen im Erbgut zur Diagnose von Long-Covid und zur Abgrenzung besonderer Long-Covid-Untergruppen genutzt werden können, und ob monogene, also durch Veränderungen in einem einzelnen Gen verursachte Formen von Long-Covid vorhanden sind.
Dafür werden möglichst heterogen betroffene Patienten aus den verschiedenen Bereichen der Gesundheitsversorgung sowie der Allgemeinbevölkerung inkludiert, um in der Untersuchung eine größtmögliche Variabilität an klinischen Ausprägungen von Long-Covid abzubilden. Die Rekrutierung erfolgt unter anderem in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kollegen, Instituten der Hausarzt- bzw. Allgemeinmedizin und über Aufrufe in den Medien. Angewendet wird anschließend die Methode der Genomsequenzierung, bei der nahezu die gesamte Erbinformation einer Person basierend auf einer Blutprobe abgebildet wird. Die genomLC-Studie wird also untersuchen, ob eine genetische Diagnostik eine frühzeitigere und genauere Diagnose ermöglicht und die Einordnung von Betroffenen in Subgruppen bei Long-Covid erleichtert. „Davon erhoffen wir uns weitere Erkenntnisse über das Erkrankungsbild und für die Behandlung. Gelingt es uns monogene Long-Covid-Formen bei den Betroffenen zu identifizieren, können eventuell maßgeschneiderte Behandlungen entwickelt werden, die individuell auf die genetischen Besonderheiten der Patienten angepasst sind.“
Bis heute sind die Ursachen für die Spätfolgen einer Corona-Infektion kaum entschlüsselt, was die Entwicklung von Arzneimitteln speziell für die Therapie von Long- und Post-Covid erschwert.
Das Forschungsprojekt genomLC vom Institut für Humangenetik des UKB ist eines von 30 Projekten, die im Rahmen des Förderschwerpunkts „Erforschung und Stärkung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die Langzeitfolgen von Covid-19 (Long Covid)“ vom BMG gefördert werden. Der Förderschwerpunkt gliedert sich in mehrere Module, die sich der integrierten bzw. koordinierten Versorgung, Innovationen in der Versorgung (z.B. Wearables) sowie der Erforschung der Versorgungslage und der Erkrankungen widmen werden. Für diesen von 2024 bis 2028 laufenden Förderschwerpunkt wurden Projekte mit einem Gesamtvolumen von 73 Millionen Euro bewilligt.
Quelle: Universitätsklinikum Bonn
02.04.2025