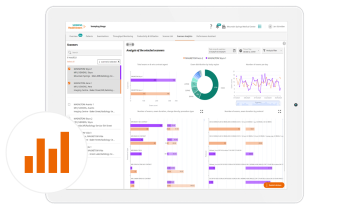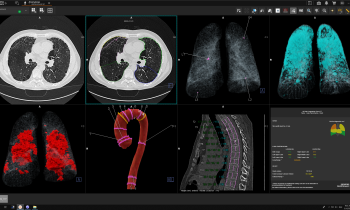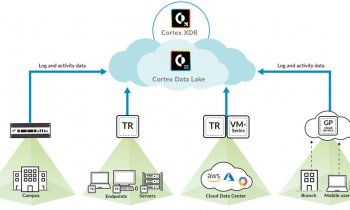Portale in der Schweiz
Semantische Interoperabilität mit Zuweisern benötigt
Das Bedürfnis nach interoperablen Lösungen ist groß, auch in der Schweiz. Denn immer häufiger erfolgt die bildgebende Diagnostik beim Hausarzt und auch in kleineren Spitälern ganz oder teilweise über eine externe Radiologie. Eine Lösung mit Radiologie Portalen ist dabei aus eHealth-Perspektive ein unbefriedigender Ansatz, da auf der Seite des Zuweisers die IT-Infrastruktur nicht wirklich eingebunden ist. Die Zuweiser sind gezwungen, sich auf unterschiedliche Portale einzustellen, in die sie ihre Radiologieaufträge eingeben und die Bilder und/oder Befunde abfragen. Eine echte Interoperabilität ist damit nicht gegeben.
Für einen Medienbruch-freien Prozess bedarf es einer echten Interoperabilität zwischen der IT-Infrastruktur des Zuweisers und derjenigen der beauftragten Radiologie. Wirtschaftlich ist dabei nur eine standardisierte Lösung. Die große Herausforderung besteht also darin, einen gemeinsamen Nenner zu finden, der die zu übermittelnden Inhalte und deren Strukturen gleichermaßen berücksichtigt. Jürg Peter Bleuer, Geschäftsführer der Healthevidence GmbH in der Schweiz, erläutert, wie ein Konsens zur "idealen Zuweisung" aussehen muss.
Interview: Daniela Zimmermann

Herr Bleuer, Sie sehen die Anmeldung des Zuweisers über Formulare bzw. Portallösungen mit gemischten Gefühlen. Warum?
Bleuer: Das Problem liegt darin, dass die Portallösungen, die internetbasierte Zuweisungen für radiologische Untersuchungen anbieten, nicht wirklich interoperabel sind. Portale müssen in der Regel händisch bedient werden. Der Zuweiser arbeitet immer mit der IT der jeweilig anderen Institution. Die entsprechenden Daten, die er eingibt, liegen damit im eigenen System nicht automatisch als Kopie vor. Das gleiche Spiel gilt auch umgekehrt, denn der Zuweiser muss bei einer Portallösung die diagnostischen Ergebnisse auch abholen. Dieser Sachverhalt ist aus der eHealth-Perspektive nicht befriedigend. Der Prozess wird vor allem deswegen sehr häufig implementiert, weil er wesentlich weniger Anforderungen im Bereich der Standardisierungen mit sich bringt. Echte Interoperabilität versteht sich aber als ein Zusammenspiel von IT-Applikationen.
Das Problem liegt dann vor allem beim Zuweiser, der sich immer wieder neu einarbeiten muss. Er überträgt Daten in die Portale und holt sie auch wieder ab. Das ist wie ein Gang zur Post, oder?
Bleuer: Ja, genau, das entspricht dem Ablauf an einem Postschalter. Man gibt den Zuweisungsbrief ab und kann das Paket mit den Ergebnissen später abholen.
Wie stellen Sie sich interoperable Lösungen idealerweise vor?
Bleuer: Ideal ist eine standardisierte Kommunikation auf der Basis internationaler Standards wie HL7 und DICOM. IHE gibt dafür in zahlreichen Profilen die Best-Practice zu verschiedenen Anwendungsfällen vor, weitere befinden sich in der Entwicklung oder müssen noch entwickelt werden. Das Wesentliche ist, dass eine solche Kommunikation nicht nur auf technischer Ebene interoperabel ist, sondern vor allem die semantische Interoperablität sicherstellt und damit auch eine Prozess-Interoperabilität zwischen den Beteiligten ermöglicht. Sprich, das empfangende System versteht, was das sendende System mit den Daten, die es übermittelt, meint. Somit kann ohne Medienbruch zwischen den Institutionen gearbeitet werden. Das muss das Ziel von eHealth sein.
Warum geschieht das nicht? Sind Aufwand und Kosten zu groß oder gibt es Sicherheitsbedenken?
Bleuer: Die Sicherheitsprobleme sind durchaus lösbar. Es ist auch nicht so, dass es nicht funktionieren wird – aber es geht langsam. Technisch ist die Interoperabilität zwischen den Systemen gegeben, semantisch jedoch noch nicht: Die angeforderten Untersuchungen können beispielsweise nicht als Freitext übermitteln werden; es bedarf einer Kodierung, also eines gemeinsamen Verständnisses, was mit einem bestimmten Ausdruck gemeint ist. In anderen Gebieten ist man in dieser Richtung bereits fortgeschritten, beispielsweise im Laborbereich. Die Radiologie steht da noch am Anfang.
Und wie geht es nun weiter?
Bleuer: Wir müssen in kleinen Schritten vorwärts gehen, sowohl bei der Auftragserteilung als auch bei den Bildern und Befundberichten. Bei letzteren lautet das Stichwort „strukturierte Befunde“. Für den Radiologieauftrag braucht es ebenfalls eine Standardisierung.
In welchen Gremien diskutieren Sie diese Herausforderungen in der Schweiz?
Bleuer: Wir haben eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Schweizer Gesellschaft für Radiologie, der HL7 Benutzergruppe Schweiz und IHE Suisse ins Leben gerufen. Ein Schweizer Alleingang ist jedoch nicht zielführend, das Ziel muss im DACH-Raum gemeinsam angegangen werden. Deshalb arbeiten wir vernetzt. Zurzeit beschäftigt uns die Bestandsaufnahme der heute verwendeten Attribute in den Radiologiezuweisungen. Darauf basierend werden wir einen Vorschlag ausarbeiten, wie eine standardisierte Zuweisung für radiologische Untersuchungen aussehen könnte. Wie aufwendig die Konsensfindung sein wird, wird die Zukunft zeigen.
PROFIL:
Juerg Peter Bleuer ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH sowie Geschäftsführer der Healthevidence GmbH. Außerdem ist er Autor/Co-Autor mehrerer Implementationsleitfäden und Grundlagenpapieren für eHealth sowie Dozent für Interoperabilität, Semantik, IHE und HL7, u. a. an der Berner Fachhochschule.
17.06.2015