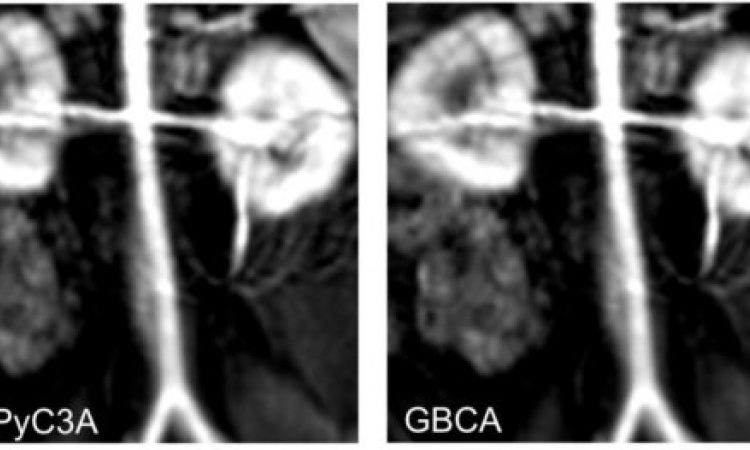Keine Chance für Schema F
Warum die Therapie von Leberkrebs nach individuellen Lösungen verlangt
Bei der großen Auswahl an interventionellen Therapiemöglichkeiten bei Lebertumoren kann man schon einmal den Überblick verlieren. Dabei besteht das Problem nicht so sehr in dem üblichen „Wer die Wahl hat, hat die Qual“.


Vielmehr kann man kaum auf wissenschaftliche Daten zurückgreifen, wenn es um die Frage geht, welches Verfahren wann bei welchem Patienten den größten Erfolg verspricht. Warum das so ist und wie man über pathophysiologisch-onkologische Konzepte die für den jeweiligen Patienten am besten geeignete Intervention ableiten kann, erklärt Prof. Dr. Christiane Kuhl, Direktorin der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Aachen, auf dem RadiologieKongressRuhr.
Eine entscheidende Rolle bei der Auswahl eines geeigneten Therapieverfahrens bei Leberkrebs spielt die Art des Tumors. Allein für die transarterielle Therapie unterscheidet sich die Wahl des Chemotherapeutikums beziehungsweise des zytotoxischen Agens, die Wahl des Embolisates, die Art der interventionellen Vorgehensweise, die Art der zeitlichen Abfolge der TACE-Sitzungen und schließlich die Art der Nachsorge ganz wesentlich für primäre (HCC) und sekundäre Lebertumoren. Vieles, was derzeit gängige Praxis ist, ist aber eher Tradition als auf Evidenz beruhende Vorgehensweise. „So ist etwa der Benefit von zytostatischen Medikamenten bei der TACE-Behandlung des hepatozellulären Karzinoms durchaus umstritten“, sagt Prof. Kuhl, „trotzdem werden sie in großem Umfang verabreicht.“ Die am häufigsten für die HCC-TACE eingesetzten Zytostatika sind Anthracycline wie zum Beispiel Doxorubicin. Dazu die Radiologin: „Aus onkologischer Sicht gibt es wenig Anhaltspunkte dafür, dass ein HCC auf diesen Wirkstoff überhaupt reagiert. Das einzige Systemtherapeutikum, das beim HCC erwiesenermaßen hilfreich ist, ist Sorafenib (Handelsname: Nexavar). Dabei handelt es sich aber eben nicht um ein Zytostatikum, sondern um einen Tyrosinkinase- Inhibitor mit antiangiogenetischer Wirkung.“ Daraus – wie auch aus einigen neueren klinischen Studien – sei zu schließen, dass die Unterbindung der arteriellen Perfusion für die lokale Kontrolle wichtiger ist als die zytostatische Wirkung. Kurz: dass der Embolisationsanteil der TACE wichtiger ist als das verabreichte Chemotherapeutikum. „Bei sekundären Lebertumoren verhält es sich genau umgekehrt“, so Kuhl.
Die Schwierigkeit der systematischen wissenschaftlichen Evaluierung liegt ihrer ihrer Ansicht nach unter anderem auch in der Natur der interventionellen Verfahren selbst begründet. Denn sie lassen sich nur schwer in das Schnittmuster prospektiver randomisierter Studien pressen, meint Kuhl: „Die interventionelle Radiologie ist eigentlich genau das, was man als Personalized Medicine bezeichnen sollte.“ Paradoxerweise wurde dieser Begriff aber für die neueren antikörperbasierten Systemtherapeutika geprägt. „Die jedoch“, betont Kuhl, „wirken noch nicht einmal annähernd so individuell maßgeschneidert wie das, was wir als interventionelle Radiologen leisten können.“ Denn die interventionelle Radiologie behandelt nur dort, wo der Tumor konkret sitzt. Sie ist also perfekt auf den einzelnen Fall zugeschnitten. „Je individueller aber das Vorgehen ist und je mehr Möglichkeiten wir haben, unsere Verfahren den Patienten auch kombiniert anzubieten, umso schwieriger wird es, standardisierte Vorgehensweisen für große klinische Studien umzusetzen.“ Es gibt hier kein Schema F, wie man es von der System- oder Chemotherapie kennt. Hinzu kommt, dass die lokale Effektivität des Eingriffs letztlich auch vom individuellen Können des behandelnden Arztes abhängt. „Die verabreichte Pille wirkt immer gleich, egal, wer sie dem Patienten verabreicht. Für interventionelle Verfahren stimmt das nicht. In dieser Hinsicht haben interventionelle Radiologen ähnliche Probleme mit der Umsetzung prospektiv-randomisierter Studien wie die Chirurgen.“
Neben dem technischen Geschick des Arztes kommt es außerdem auf das onkologische Verständnis des Einzelnen an. Das sei nicht immer vorhanden, räumt die Professorin ein: „Die interventionelle Radiologie ist ein riesiger Gemischtwarenladen, in dem der größte gemeinsame Nenner darin besteht, dass ein Eingriff unter Bildkontrolle erfolgt. Mit ausgerechnet dieser Begründung wehren sich viele Radiologen gegen die Übergriffe aus anderen Fachdisziplinen und verweisen darauf, dass die Bildgebung ihr Hoheitsgebiet sei. Ehrlicherweise muss man jedoch sagen, dass der Radiologe nicht automatisch zum Fachmann in der Behandlung von gefäßmedizinischen oder onkologischen Erkrankungen wird, nur weil er die Intervention ausführt. Wer sich als Radiologe also nicht bloß zum Erfüllungsgehilfen des behandelnden Arztes machen möchte, muss wissen, welche Therapieform unter medizinischen Gesichtspunkten für welchen Patienten sinnvoll erscheint.“
Deshalb plädiert Prof. Kuhl für eine weiterführende Spezialisierung innerhalb der interventionellen Radiologie. Im Fall der onkologischen Fachausrichtung würde das bedeuten, dass der Radiologe, der einer Tumorkonferenz beisitzt, sich ähnlich gut in der Systemtherapie der soliden Tumoren auskennen sollte wie seine Kollegen. „Dazu gehört zum Beispiel auch, über die Prognosen des Patienten Bescheid zu wissen“, erklärt Kuhl. „Nur dann kann der Radiologe einschätzen, wann es sich lohnt, sich für die eigene Sache stark zu machen, und wann er sich besser bedeckt hält. In vielen Einrichtungen wird der Radiologe von den Kollegen anderer Fachrichtungen im Tumorboard heute noch nicht als Therapeut wahrgenommen, sondern als Handwerker, der eine Dienstleistung ausführt, die ein anderer angeordnet hat. „Die Radiologen müssen sich von der Rolle des internen Dienstleisters, der nur auf Veranlassung Dritter interventionelle Leistungen durchführt, lösen und eine eigene therapeutische wie auch diagnostische Verantwortung für den Patienten übernehmen. Das müssen die Radiologen wollen – verordnen kann man das nicht. Aber nur so werden wir als Fachleute für lokaltherapeutische Verfahren anerkannt werden.“ Das gelte für vermutlich alle interventionellen Verfahren, aber ganz besonders für die interventionelle Onkologie, da die Behandlungskonzepte für onkologische Patienten zunehmend interdisziplinär angelegt werden. „Hier haben wir also eine große Chance, uns einzubringen“, so Kuhl.
Ein besseres Standing im Behandlungsteam könnte auch der Schlüssel zu mehr wissenschaftlichen Studien auf dem Gebiet der interventionellen Lebertherapie sein, lautet Kuhls Fazit: „Es ist schwierig, Patienten in seine eigene Studie einzuschließen, wenn man nicht selbst als behandelnder Arzt anerkannt ist. Schließlich gibt man dadurch die gesamte Therapierichtung vor. Das wird nur möglich sein, wenn der Radiologe in der Lage ist, dem Onkologen auf Augenhöhe zu begegnen.“
24.10.2012