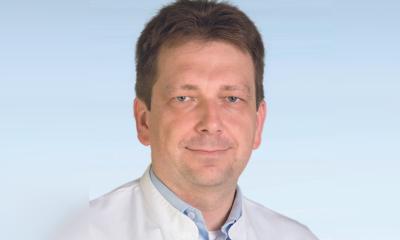Evidenz statt Heldentum
Konflikt- und Krisensituationen stellen die medizinische Versorgung vor spezifische Herausforderungen, die nur auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz im Austausch von akademischer und der vor Ort tätigen Chirurgie zu bewältigen sind. Der EFORT-Kongress in London bietet dafür eine wichtige Drehscheibe auf europäischer Ebene an.

„Die Zunahme bewaffneter Konflikten, auch in Europa, verdeutlicht die Notwendigkeit einer adäquaten Ausbildung für die Bewältigung spezifischer Krankheits- und Verletzungsbilder, wie sie etwa bei Schussverletzungen oder Explosionen auftreten. Die akademische Chirurgie geht bislang nicht ausreichend auf die Spezifika der Traumatologie und Orthopädie in Konfliktsituationen ein“, betonte heute der Unfallchirurg Dr. Bernhard Ciritsis (Zürich) beim 15. EFORT Kongress in London, wo mehr als 7.000 Teilnehmer/-innen aus aller Welt zusammentreffen.
Bei diesem wichtigsten wissenschaftlichen Großereignis für Orthopädie und Unfallchirurgie auf europäischer Ebene, organisiert von der European Federation of National Assiciations of Othopaedics and Traumatology (EFORT) gemeinsam mit der British Orthopaedic Association (BOA), war genau diesen spezifischen Anforderungen in Kriegs- und Krisensituationeneine eigene wissenschaftliche Sitzung gewidmet. „Der EFORT Kongress ist außerhalb des angloamerikanischen Raums die einzige Drehscheibe dieser Größenordnung zur Vermittlung zwischen akademischer Chirurgie und der Chirurgie in Konfliktsituationen mit dem Ziel, evidenzbasierte Schlussfolgerungen zu generieren und aus dem Expertenaustausch beide Seiten weiterzuentwickeln“, so Dr. Ciritsis.
„Das Themenfeld ist nicht auf Kriegssituationen beschränkt, sondern umfasst alle Arten von Konfliktszenarien und Naturkatastrophen wie Tsunamis, Überschwemmungen, Erdbeben, Massenpaniken oder Explosionsverletzungen. In guter Zusammenarbeit mit dem IKRK, Médecins Sans Frontières (MSF) sowie Militäreinheiten konnte ein wissenschaftliches Netzwerk aufgebaut werden, bei dem es um vermittelbare, objektivierbare Fakten unter dem Anspruch der Nachhaltigkeit geht. Bloße Erfahrungsberichte würden die Gefahr tendenzieller Klischeebedienung vor allem von Stereotypen über Entwicklungsländern in sich bergen. Dieser Anspruch macht den EFORT-Kongress zu einer wichtigen Instanz und verleiht ihm Exklusivitätscharakter“, sagt Dr. Ciritsis.
Kongressteilnehmer/-innen diskutierten Themen wie Qualitätsstandards in der Chirurgie unter prekären Bedingungen, die Folgen einer langfristigen Präsenz humanitärer Organisationen in Entwicklungsländern, Behandlungsstrategien bei Naturkatastrophen, das Management eines Massenanfall von Verletzten und Erkrankten sowie die Analyse von Schussverletzungen anhand eines vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) generierten Algorithmus.
Notwendigkeit spezifischer Algorithmen
Ballistische Traumata bzw. Schusswunden weisen eine mit Verkehrsunfällen nicht vergleichbare Biomechanik und Kinetik auf, wodurch Behandler/-innen mit einem eigenen Krankheitsbild konfrontiert sind. „Die einzig bislang vorliegende Klassifizierung stammt vom IKRK mit einer eigenen Datenbank, worüber kein Universitätsspital verfügt. Die Klassifizierung ballistischer Traumata ist für die Erstellung eines Algorithmus in der Notfallmedizin unerlässlich“, erklärte Dr. Ciritsis. Ohne Algorithmus können lebensrettende Maßnahmen unter Umständen nicht in der erforderlichen Schnelligkeit gesetzt werden.
Die Notwendigkeit evidenzbasierter Schlüsse und spezifischer Algorithmen zeigt sich auch bei Minenverletzungen oder Erdbebenopfern mit charakteristischen Quetschungen, Liegetraumata und offenen Frakturen, wovon die Erdbebenkatastrophe auf Haiti ein extremes Zeugnis gibt. „Die Durchführung von Amputationen an den Extremitäten verlangt im Hinblick auf eine adäquate Prothetik und das Bemühen um einen weitestmöglichen motorischen Funktionserhalt ebenfalls eine wissenschaftlich fundiertes Wissen und nicht einfach ein Abschneiden einer Gliedmaße“, so der Experte.
Bedrohung des medizinischen Personals nimmt zu
Eine wichtige Frage ist auch das Problem der medizinischen Versorgung in Konfliktsituationen. In Krisen- und Kriegsregionen wie etwa Somalia oder Syrien haben viele Menschen angesichts der Bedrohungslage keine Zugangsmöglichkeit zu einer medizinischen Versorgung. „Kriege sind urbaner und subtiler geworden, Angriffe an vulnerablen Punkten und damit auch die Bedrohung des medizinischen Personals nehmen zu. Die Verbesserung der Sicherheit der betroffenen Bevölkerung und der medizinischen Versorgungskräfte ist somit ein zentraler Aspekt der Chirurgie in Konfliktsituationen“, betonte Dr. Ciritsis.
Absage an „neokolonialistische Muster“
Mit einem „Freiwild-Gedanken“ habe die chirurgische Arbeit in Konfliktsituationen nichts gemein, die Einhaltung universeller medizinethischer Prämissen ist ebenso unerlässlich wie die strikte Absage an jeder Form von neokolonialistischen Denk- und Verhaltensmustern oder an Dispositionen im Fahrwasser einer Zwei-Klassen-Medizin. Auch wenn angesichts der oft prekären Arbeitsbedingungen das Prinzip „keep it simple“ gilt, seien die gleichen medizinischen Maßstäbe wie in einem Krankenhaus in westlichen Industrienationen einzuhalten, so Dr. Ciritsis. „Die Medizin in Krisen- und Konfliktsituationen erlaubt kein vermeintliches Heldentum oder die Selbststilisierung zur One-Man-Show. Medizinische Abläufe in solchen Extremsituationen funktionieren nur unter Einhaltung maximaler Disziplin und der gleichwertigen Zusammenarbeit aller im Team, vom medizinischen und pflegerischen bis zum logistischen Personal einschließlich der lokalen Mitarbeiter. Die Grundhaltung des Respekts ist dafür ebenso notwendig wie Professionalität, die ein breites Qualifikationsspektrum von der Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Orthopädie bis hin zur Kinder-, Mikro- und rekonstruktiven Chirurgie umfasst.“
06.06.2014